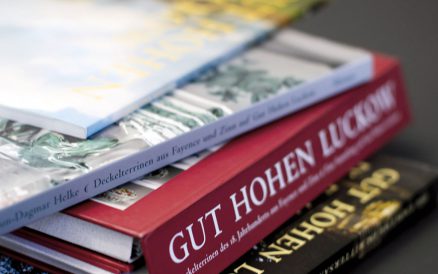Kunst und Kultur
Kunst- und Landschaftspark
Kunstwerke
Etwa 20 Künstler haben den Park mit einer oder mehreren Arbeiten bereichert und ihn als Bühne für ihre Kunst genutzt. Manchmal fällt ein Kunstwerk direkt ins Auge, ein anderes Mal entdeckt man sie zufällig in einer Nische oder sieht erst auf den zweiten Blick, dass es sich um ein Kunstwerk handelt, wie bei dem Brunnen an der hinteren Freitreppe des Herrenhauses. Einige bringt der Wind zum Klingen, andere laden als Stuhl oder Bank zum Verweilen ein.

Eindrucksvoll sind die vielfach verarbeiteten Granitfindlinge, die so typisch für den Ort und die Region sind. Als ›lokaler Liebling‹ ist der Schreiende Hengst zu bezeichnen. 1986 wurde der erste Abguss dieser Arbeit von Jo Jastram gefertigt, in der Ahnung und Gegenwart der Vorwendezeit präsent sind. 2002 wurde diese letzte in der DDR entworfene Großplastik für den Park in Hohen Luckow erworben. Direkt in seiner Nachbarschaft kamen zuletzt drei modellartig vergrößerte Keimlinge hinzu, die aus vor Ort gefundenem, filigran verwobenem Holzbruch bestehen. Mecklenburger Künstler treffen auf weitgereiste Gäste, so wie die Besucher sowohl aus dem Umland als auch von weither kommen. Genau dies entspricht der Intention, die schon den Bildtiteln abzulesen ist: Dieser Park ist ein Ort der Begegnung, an dem über die Beziehunge von Menschen und Natur nachgedacht werden kann, wie auch ein Treffpunkt für gesellige Anlässe.
Baumrundgang
Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Konzept des streng symmetrischen Barockgartens aufgegeben und ein weitläufiger englischer Landschaftspark mit verschlungenen Wegen, Teichen, Sichtachsen und Pflanzinseln angelegt. Alles was gepflanzt und gepflegt wird, soll auch kommende Generationen erfreuen. Beim Durchstreifen wird der Blick auf Kunstwerke, besondere Bäume, Gebäude oder die wellige Endmoränenlandschaft mit ihren Feldern und Wiesen geleitet.
Zwei markante Bäume – Esskastanie und Stieleiche – stammen noch aus der Zeit der barocken Gartenanlage. Sie wurden um 1710 gepflanzt. Viele prächtig ausgebildete, heimische Arten sind inzwischen 150 Jahre alt. Seltene Sorten wie die kaukasische Flügelnuss bieten einen überraschenden Anblick. Über 40 Baumarten wechseln sich als Solitärbäume, in Pflanzgruppen oder kleinen Wäldchen ab. In den ›Bunten Metern‹ – den Blühinseln – erfreuen Blumen von März bis November Auge und Nase.
Wissenswertes zu Pflanzenarten und Kunstwerken sowie zur Geschichte und Parkgestatung vermittelt der digitale Rundgang, den Sie vor Ort auch über Ihr Smartphone abrufen können. Am Info-Punkt ist zudem ein gedruckter Faltplan erhältlich.
Parkplan

(M)ein Lieblingsort

Einen Ort im Park liebt der Gärtner Florian Golchert besonders: Er wird von einer mächtigen Buche überspannt. Sehr still ist es in diesem Gartenraum, dessen Blätterwände nur vereinzelte Blicke auf den Park und das Umland freigeben – ein typischer Eindruck in einem Landschaftspark, der ein Stück bewusst dezent gestalteter Natur darstellt. Für Florian und sein Gärtnerteam lautet das Credo: »Der Park soll gepflegt aussehen, jedoch nicht wie ein Fremdkörper in der Natur wirken. Deshalb versuchen wir die Übergänge fließend zu gestalten.«
Das betrifft insbesondere die Schnittstelle zum Dorf und die natürlichen Bereiche zwischen und in den Feldern. So spielen zu gestaltende Flächen bei der Dorfentwicklung eine wichtige Rolle. Bepflanzung und Pflege sind auch hier zukunftsorientierte Maßnahmen. Die für Flora und Fauna so wichtigen Feldränder und Kopfweidenbestände werden ebenfalls betreut und sachkundig beschnitten. Mit seinem beständigen Einsatz trägt des Hohen Luckower Gärtnerteam maßgeblich dazu bei, dass der Reiz unserer in Jahrhunderten gewachsenen Mecklenburgischen Kulturlandschaft erhalten bleibt.